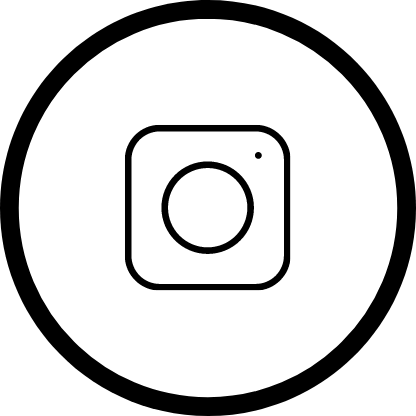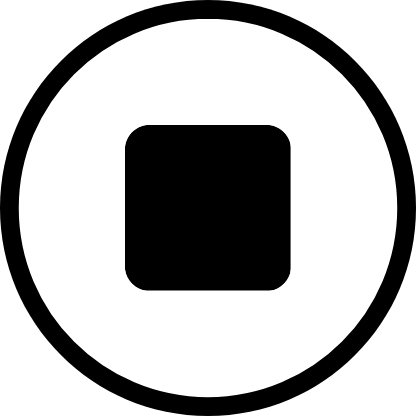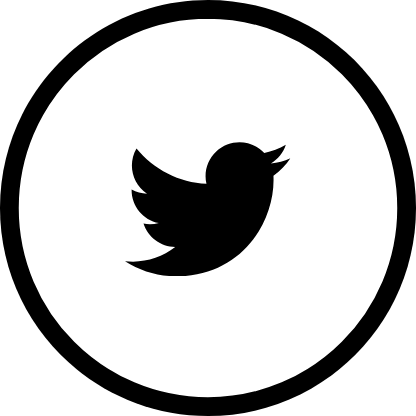24. Mai 2012 – Wolfram Weimer
Das Grundproblem des heutigen Journalismus: Gefallsucht und Mitteismus
Wenn Bild und Süddeutsche Zeitung sich früher zankten, dann ging es um Politik, um rechts und links, um oben und unten in der Gesellschaft. Wenn sie sich heute streiten, dann geht es um einen Preis, um Ruhm und roten Teppich, um oben und unten – auf der Bühne. Die Debatte um den Henri-Nannen-Preis entlarvt weniger alte Ressentiments als neue Eitelkeiten.
Das Problem beginnt damit, dass wir Journalisten überhaupt Preise haben wollen. Im Grunde sollte uns das wesensfremd sein – so wie Polizisten, Richter und Notärzte auch keine Preise für ihre Arbeit wollen sollten. Wir sind eine Instanz der Unabhängigkeit, der Kritik, der Machtkontrolle, der Distanz zu Bühnen. Wir werden gebraucht, wenn wir Bühnenspiele hinterfragen und uns unbeliebt machen. In den letzten Jahren aber, wollen sich immer mehr von uns beliebt machen – auch jenseits der Preisverleihungen. Die Aufmerksamkeitsökonomie und ihre Währung „Beliebtheit” ist für den politischen Journalismus ein süßes Gift. Wenn Giovanni di Lorenzo davon berichtet, dass man früher für die Talkshows nach den Schwachpunkten der Gäste und kritischen Ansätzen gefahndet habe, heute aber vor allem nach dem Unterhaltungs- und Stimmungswert frage, dann ist das ein Alarmsignal und verweist auf ein grundlegendes Problem.
Wir etablieren im Journalismus zusehends eine seltsame Hierarchie von Wichtigkeiten, die die kritische Intelligenz immer geringer schätzt, die affirmative höher und die inszenatorische am höchsten. Das Entlarvte ist uns zusehends weniger wert als das Erzählte und noch weniger als das Unterhaltende.
Reporter und Rechercheure, Kritikaster und Kämpfer gegen das Falsche – die konzentrierte Sphäre der journalistischen Integrität, die altmodischen Wahrheitssucher also haben Qualitätsmedien groß und vor allem wichtig gemacht. Es gab dereinst sogar einen Kampf um Wahrheit und Wirklichkeit, woraufhin Journalisten einander über Inhalte Feinde werden konnten. Vorbei. Heute wollen wir häufig eines: gefallen. Die Welt der Bühne hat die der Kulisse als Sehnsuchtsort abgelöst. Man mag die Possierlichkeit der Postmoderne, den Druck der Internetrevolution und den Triumph des Unterhaltungsjournalismus dafür schelten. Die Folgen sind jedenfalls unübersehbar. Unser Beruf wird zusehends von einer kulturellen Haltung des Spielerischen, des Unernstes, der Eitelkeiten geprägt, weil wir die Hierarchie der Wahrheiten durch eine Hierarchie der Gefälligkeiten ersetzen.
Wenn aber das Kleid des Marketings den Journalismus umschmeichelt, wenn wir immer weniger auf das hören, was einer zu sagen hat, als auf das, wie und wo und vor wie vielen er es sagt, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass der Journalismus eine ähnliche Glaubwürdigkeitskrise wie die Politik erleidet. Die Menschen durchschauen unser schillerndes Äußerlichkeitskleid als lichtes Nachthemd.
Die wichtigste Ursache der journalistischen Krise liegt in der Auflösung von Wahrheiten zu diskursiven Konsensen. Wir fragen immer weniger danach, was wir für richtig halten, sondern danach, was andere für richtig halten könnten. So stützt sich die Politik am liebsten auf Umfragen, die Wirtschaft orientiert sich an der Marktforschung und der Journalismus huldigt der Wohlfühl-Unterhaltungs-Quote. Alles nachvollziehbar – nur zahlen wir mit diesen chamäleonhaften Techniken der Vermittung unseres Bewusstseins einen Preis der opportunistischen Verflachung.
Die Mode der Wahrheitsfindung durch diesen Mitte-ismus schien anfangs eine erfrischende Befreiung von den bleiernen Kämpfen der ideologischen Zeit. Inzwischen ist sie für den Journalismus wie ein Verrat an sich selbst. Wenn sich nämlich in immer mehr Diskursen alle auf einem winzigen Fleck konsensualer Mitte versammeln, dann wird es argumentativ ziemlich eng, dann werden nötige Debatten durch Wohlfühlplatitüden ersetzt. Denn der Drang in die politisch korrekte Mitte erzeugt einen Journalismus, der sich massen- und mehrheitskonform seicht dahin biegt. Wir haben hernach in vielen Debatten von der SZ bis zur Bild, von der FAZ bis zum Spiegel gleiche Meinungen.
Abweichlertum, Originalität, Eigenheit wirken in dieser superkonformen Medienwelt der Vollkaskomeinungen wie Antiquitäten aus längst versunkenen Zeiten. Man gibt sich eben auch als Journalist lieber geschmeidigen Netzwerken hin, Meinungstrends und Stimmungs-Communities, weil sie kollektive Bande einer Welt sind, die die Wahrheit fürchtet wie der Chorknabe das Solo. Am Ende streitet man nicht mehr um eine Sache, sondern um eine Äußerlichkeit, nicht mehr um Politik, sondern um Preise. Schade eigentlich. Denn wenn Pestalozzi Recht hat („Die Masse und der Staat haben keine Tugend, nur das Individuum hat sie!”), dann wird der einzelne Journalist als kritische Instanz gebraucht. Egal ob er bei der Bild oder bei der SZ arbeitet und ob er bei Preisen leer ausgeht. Vielleicht sogar dann erst Recht.
Wolfram Weimer, 47, war Chefredakteur des Focus und ist heute Besitzer der Börse am Sonntag. Seine neues Buch „Heimspiel“ ist eine Realsatire auf den politisch-medialen Betrieb.