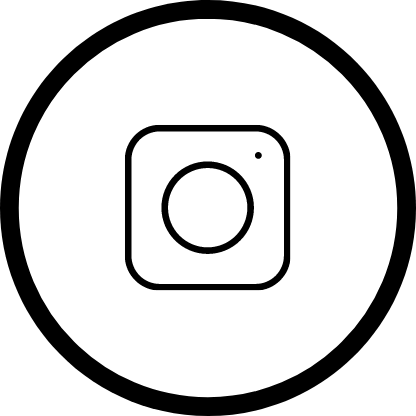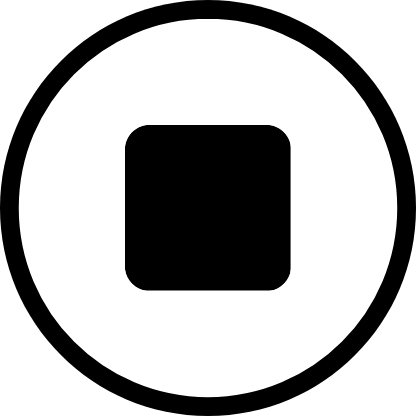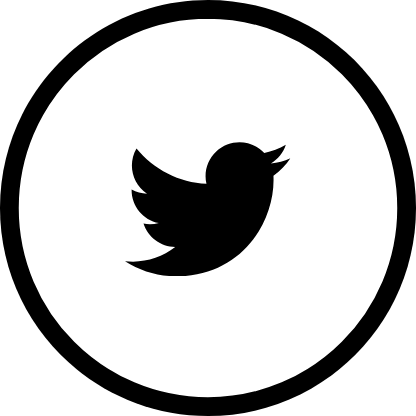Leuchtturm-Preisträger 2012: Rene Wappler (“Spremberger Rundschau”) und Wolfgang Kaes (“Bonner Generalanzeiger”)
Laudator: Markus Grill, Vorstand Netzwerk Recherche
Sehr geehrter Herr Ude,
sehr geehrte Damen und Herren,
lieber Herr Prantl,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
lieber Herr Kaes, lieber Herr Wappler,
kann man überhaupt investigativ arbeiten, ohne ein Netz geheimer Informanten zu haben? Ohne eine prall gefüllte Spesenkasse und ohne die Hausjuristen eines großen Verlags im Rücken? Kann man in einer Lokalredaktion überhaupt gründlich und hartnäckig recherchieren? Oder soll man dieses Geschäft nicht lieber den großen Blättern in Hamburg und München überlassen?
Das “Netzwerk Recherche” vergibt heute Abend seinen “Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen” und wir freuen uns, dass der Preis in diesem Jahr passenderweise an zwei Journalisten geht, die bei Lokal- und Regionalzeitungen arbeiten und die all das, was ich eben aufgezählt habe, in ihrem Alltag nicht zur Verfügung haben.
Der erste “Leuchtturm” 2012 geht an die Lokalredaktion Spremberg der “Lausitzer Rundschau” für ihre hartnäckigen Recherchen zum Rechtsextremismus vor Ort. Rene Wappler und seine Kollegen haben sich auch nicht abschrecken lassen durch Attacken auf die Redaktion und konsequent über die Neonazis vor Ort recherchiert.
Der zweite “Leuchtturm” geht an einen Journalisten mitten im Herz der alten Bundesrepublik, an Wolfgang Kaes vom Bonner “Generalanzeiger”, der zugleich auch Krimiautor ist, und der in diesem Jahr mit seinen Recherchen dazu beitrug, einen 16 Jahre alten realen Mord aufzuklären.
Doch zuerst zu den Kollegen im Osten der Republik: Spremberg ist eine Kleinstadt in Brandenburg, bis zur polnischen Grenze sind es gerade noch 25 Kilometer. Im vergangenen Jahrhundert wuchs in der Stadt der Schriftsteller Erwin Strittmatter auf, und es ist bis heute auch der einzige Name, den man außerhalb der Region noch mit Spremberg verbindet.
Knapp 24.000 Menschen leben heute in Spremberg, für den Berliner Tagesspiegel eigentlich ein “großes Dorf”. Seit der Wende sank die Zahl der Einwohner um 20 Prozent, bis 2030 wird der Rückgang 50 Prozent betragen. Mittlerweile halten nicht mal mehr die Züge der Deutschen Bahn, nur noch die private Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft verbindet Zugreisende mit dem nahegelegenen Cottbus.
Das markanteste Denkmal von Spremberg ist der Bismarckturm. Schon von Weitem kann man die Inschrift auf ihm lesen: “Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt.”
An diesem Bismarckturm trafen sich Anfang dieses Jahres mehr als 30 vermummte Neonazis mit Fahnen und Transparenten. Über dieses bis dahin geheime Treffen hatten Sie, Rene Wappler, am 28. April in der “Lausitzer Rundschau” berichtet. Einen Tag später beschmierten Unbekannte das Gebäude der Lokalredaktion Spremberg, in der Wappler arbeitet, klebten Kopien seines Artikels an die Wand und sprayten ans Schaufenster: “Lügenpresse halt die Fresse”.
In der darauffolgenden Nacht kamen die Täter erneut. Diesmal hängten sie Eingeweide eines frisch geschlachteten Tieres an das Schild der Lokalradaktion, das Blut tropfte auf den Boden.
Doch die Drohung in Mafia-Manier verfehlte ihre Wirkung. Am Tag danach sagten Sie, Herr Wappler, einer Reporterin aus Berlin: “Wir lassen uns nicht einschüchtern” und Chefredakteur Johannes Fischer erklärte: “Wir fühlen uns ermuntert, noch intensiver zu recherchieren”. Im Blatt schrieb Fischer einen Kommentar, in dem er versprach: “Ihre Heimatzeitung wird weiter Flagge zeigen”.
Wappler berichtete danach, wie die Stadtverordneten von Spremberg mit dem Problem des Rechtsextremismus umgehen, er recherchierte zusammen mit seiner Kollegin Simone Wendler die Verbindungen des örtlichen Rockerklubs zu den Neonazis und berichtete, wie der Verfassungsschutz die Szene einschätzt.
Die Reaktionen waren gespalten, sagt Wappler: Einige wenige hätten ihm anschliessend gesagt, dass sie seine Berichte gut fänden. Viele wollten mit dem Thema Rechtsextremismus aber gar nichts zu tun haben, und einige, wie der CDU-Fraktionschef Hartmut Höhna kritisierten öffentlich: “Die Medien ziehen unsere Stadt mit ihrer Art der Berichterstattung in den Dreck.”
Die These dahinter sei, so Wappler, dass man die Nazis einfach ignorieren müsse. Wenn man über sie schreibe, verschaffe man den Nazis dagegen nur eine Bühne.
Diese Ansicht sei vor allem in den neunziger Jahren verbreitet gewesen, erinnert sich Wappler. Aber sie habe sich als falsch erwiesen: Die Rechtsextremen sind nicht verschwunden, sondern treten immer unverfrorener auf: Sie organisieren Jugendcamps, fordern auf dem Marktplatz den Austritt aus dem Euro, nehmen an Tierschutz-Aktionen teil und gewinnen Abgeordnetensitze.
Die Polizei in Spremberg hat die Attacken auf die Lokalredaktion der “Lausitzer Rundschau” bisher nicht aufgeklärt. Rene Wappler sieht sich derweil neuen Nadelstichen ausgesetzt: Als er im Sommer vor seiner Redaktion eine Zigarette rauchte, explodierte neben ihm ein Knallkörper. Und als er abends von einem Stadtfest zu seinem Auto gehen wollte, “begleiteten” ihn acht Jungnazis. Die herbeigerufene Polizei riet ihm, lieber nicht direkt zu seinem Auto zu gehen.
Trotz dieser Anfeindungen bleibe der Journalismus für Sie, Herr Wappler, ein Traumberuf. Als Journalisten seien wir eben nicht nur dazu da, die angenehmen Geschichten zu machen, sondern müssten auch “durch die unangenehmen Geschichten durch”.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber ist es wirklich selbstverständlich, dass Lokalredaktionen sich gegen die Stimmung in ihrer Heimatstadt stemmen? Dass sie etwas zum Thema machen, was die Leser vielleicht gar nicht unbedingt lesen wollen?
Von seinen Recherchen und Berichten über die Rechtsradikalen in Spremberg wollen Wappler und seine Kollegen jedenfalls nicht lassen. “Ich bin in der DDR aufgewachsen und weiß, was es heißt, keine Pressefreiheit zu haben”, sagt er. “Ich bin sehr froh, dass wir die nun haben und wir sollten sie auch verteidigen.”
Ein Satz, der mich berührt, weil er zeigt, dass Sie etwas schätzen, das wir Wessis vielleicht als viel zu selbstverständlich wahrnehmen. Aber genau darum geht es: um Pressefreiheit. Die Freiheit, das zu sagen, was ist, wollen Ihnen die Nazis im Spremberg nehmen.
Mit Ihren Recherchen über die Neonazis vor Ort verteidigen Sie dieses Grundrecht ganz konkret – und Sie verteidigen es für uns alle. Dafür gebührt Ihnen großer Respekt.
Der erste Leuchtturm des “netzwerks recherche” 2012 geht an Rene Wappler und die “Spremberger Rundschau”. Herzlichen Glückwunsch!
Die unglaubliche Geschichte, die der zweite Preisträger, Wolfgang Kaes, recherchierte, begann damit, dass Ende letzten Jahres eine Annonce, die für die Anzeigenabteilung bestimmt war, aus Versehen auf seinem Schreibtisch in der Redaktion des “Bonner Generalanzeigers” landete. Es handelte sich um eine Mitteilung des Amtsgerichts Rheinsbach, dass eine gewisse Gertrud Ulmen sich bis 28. Februar 2012 in Zimmer 207 des Amtsgerichts einfinden soll – sonst werde sie für tot erklärt.
Kaes stutzte über diese acht Zeilen-Nachricht, weil er den Fall der seit 16 Jahren vermissten Arzthelferin gar nicht kannte. Er wollte eigentlich eine Geschichte recherchieren, was das für Leute seien, die plötzlich verschwinden, sagt Kaes. Aber nach ersten Gesprächen mit den Angehören hatte er schon starke Zweifel, ob Trudel Ulmen damals tatsächlich einfach so verschwunden ist.
Ihr früherer Ehemann jedenfalls meldete sie im März 1996 zunächst vermisst, erklärte aber vier Tage später, sie habe angerufen und gestanden, mit ihrem portugiesischen Liebhaber durchgebrannt zu sein. Die Polizei glaubte dem Ehemann – und schloss die Akte.
Die Familie hingegen blieb fassungslos, weil das Verschwinden anscheinend so gar nicht zu der braven Arzthelferin passte.
Kaes meldete sich bei der Familie, die ihm bereitwillig Auskunft erteilte. Auch die Freundinnen der vermissten Frau sprachen mit Kaes, Arbeitskolleginnen, Vorgesetzte und Ermittler. Einer der wenigen, die nicht mit dem Reporter sprechen wollten, war der Ehemann von Trudel Ulmen.
Am 9. Januar veröffentlichte Kaes eine Doppelseite im Bonner “Generalanzeiger” über den mysteriösen Fall vor 16 Jahren – und brachte die Polizei dazu, die Ermittlungen erneut aufzunehmen.
An dieser Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass Kaes bis zum Abitur selbst schwankte, ob er lieber Polizist oder Journalist werden sollte. Er wurde Journalist, pflegt seine kriminalistische Ader aber bis heute, in dem er Kriminalromane schreibt, die ähnlich realistisch anmuten, wie die seines Stuttgarter Kollegen Wolfgang Schorlau.
Diese gefühlte Nähe zu den Ermittlern sorgte vermutlich auch dafür, dass Kaes die Polizei in seinen Recherchen nie scharf kritisierte, “obwohl die mich anfangs angelogen haben”, wie er sagt. Er versuchte es statt dessen mit einer Umarmungsstrategie, lobte den nun einsetzenden Eifer der Ermittler – und setzte sie damit unter Zugzwang.
Außerdem habe er der Polizei seine Recherche-Ergebnisse zur Verfügung gestellt, sagt Kaes. “Ich weiss zwar, dass das Dinge waren, die Journalisten nie machen sollten, aber ich habe es trotzdem getan.”. Denn er habe sich selbst tierisch darüber geärgert, dass ein Mensch verschwinden könne, ohne dass sich jemand dafür interessiert. Er sagt: “Ich habe im Fall Trudel Ulmen auch gelernt, wie sehr sich Menschen von Behörden allein gelassen fühlen.” Für die Familie sei er, der Journalist, der letzte Hoffnungsschimmer gewesen.
Obwohl Wolfgang Kaes von der Polizei abgespeist und von der Staatsanwaltschaft abgebürstet worden war, hat er die Geschichte nicht losgelassen. Gerade aber weil Sie weiter gebohrt haben Herr Kaes, und sich nicht haben abspeisen lassen, konnten sie helfen, den Fall aufzuklären. Und genau diese Hartnäckigkeit zeichnet sie aus.
Denn erst nachdem Sie begonnen hatten, über den Fall zu berichten, führte die Polizei einen DNA-Vergleich durch mit einer bisher unbekannten Frauenleiche, die ebenfalls vor 16 Jahren nur zwanzig Kilometer vom Wohnort der Vermissten entfernt, gefunden wurde. Der Vergleich ergab, dass es sich bei der Toten tatsächlich um die vermisste Trudel Ulmen handelt.
Kurz danach gestand auch ihr Ehemann, seine Frau damals nach einem Streit mit einem Kissen erstickt zu haben.
Für Wolfgang Kaes war die Lösung des Falls eine Erleichterung – auch weil er, wie er zugibt, nicht wusste, was er noch hätte schreiben können. Niemals zuvor habe er so lange und so intensiv an einem Fall recherchiert, sagt Kaes. Mit insgesamt 62 Leuten sprach er, mit den meisten sogar in seiner Freizeit.
Was ist aber von der mangelnden Distanz zu halten, die Kaes selbst eingeräumt hat? Jeder von uns hat den meist zitierten Satz des früheren Tagesthemen-Moderators Hans-Joachim Friedrichs im Ohr: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache”.
Wolfgang Kaes hat sich gemein gemacht, zum Beispiel mit dem Anliegen der Familie, die Wahrheit über die vermisste Trudel Ulmen herauszufinden. Soll man ihn dafür tadeln? Nein.
Ich glaube, Friedrichs bekannter Satz wird heute vor allem von den Zynikern unseres Berufs benutzt, denen Engagement und Haltung hoffnungslos altmodisch vorkommen und die statt dessen ihre angeblich kritische Distanz wie eine Monstranz vor sich hertragen. Dabei lassen sie sich gleichzeitig jedes Zitat eines Mächtigen von seiner Pressestelle autorisieren.
Sie, Herr Kaes, haben sich von den Mächtigen dagegen nicht von Ihrer Geschichte abbringen lassen. Sie haben Partei ergriffen für die Schwächsten in diesem Fall: den Bruder, die Schwester und die Mutter der Ermordeten. Es war die richtige Entscheidung und die zahlreichen Reaktionen von Lesern haben Ihnen das vermutlich auch bestätigt.
Die entscheidende Rolle in Ihrer Recherche habe der Vertrauensvorschuss gespielt, den eine lokale Tageszeitung geniesse, haben Sie eingeräumt. Zu sagen: “Guten Tag, ich komme vom Bonner Generalanzeiger”, sei etwas anderes, als zu sagen, “Guten Tag, ich komme von der Bild-Zeitung”. Und sie waren erstaunt, wie viele Menschen bereit gewesen waren, mit Ihnen zu sprechen. “Ohne die lokale Nähe hätte das alles nicht funktioniert”, so Ihre Erfahrung.
Der Kern des Journalismus sei für Sie immer noch Aufklärung, auch wenn das ein großes Wort sei. “Wenn die Leute etwas lesen von mir und anschliessend glauben, einen Ausschnitt der Welt besser zu verstehen, dann hat es sich gelohnt”, sagt Wolfgang Kaes. Deshalb schreiben Sie auch realistische Krimis, bei denen zwar die Handlung erfunden sei, in denen aber dennoch die Realität beschrieben werde.
Für mich zeigen Rene Wappler und Wolfgang Kaes, dass es keine Frage des Blattes ist, für das man arbeitet, ob man großartige Recherchen zustande bringt. Mit der Neugier, dem eigenständigen Denken und dem Dickschädel, den sie an den Tag gelegt haben, sind sie Vorbilder auch für andere Journalisten. Deshalb erhalten Sie beide heute den “Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen”.
Herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden!